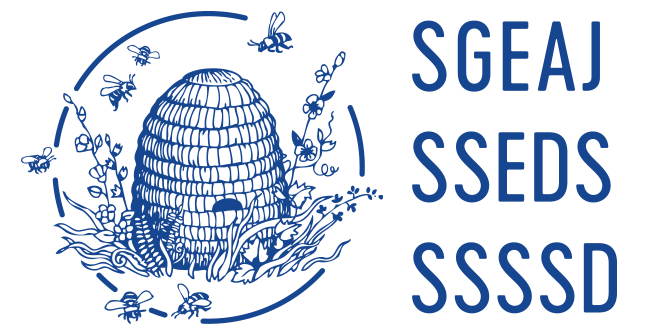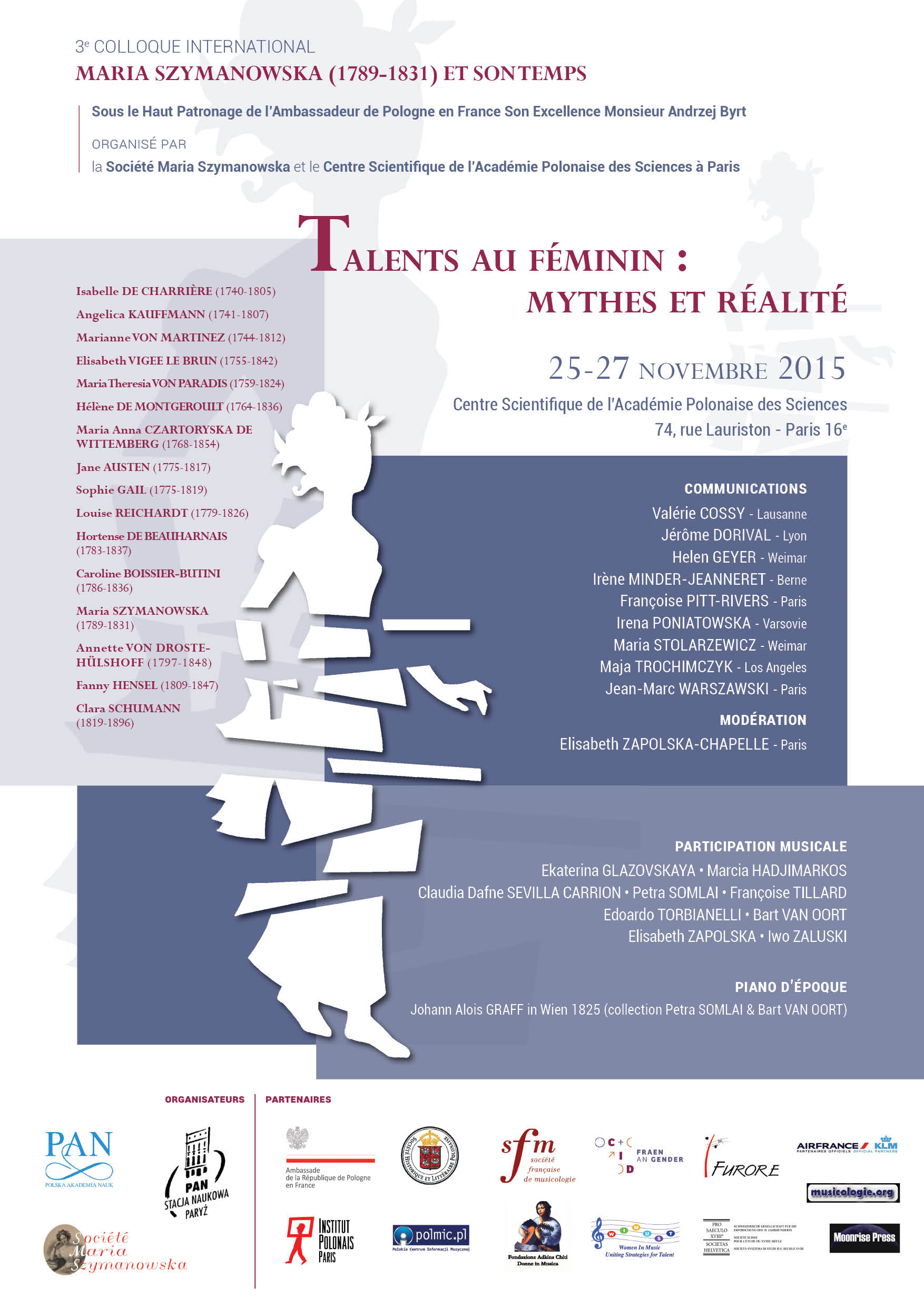Eine Wanderausstellung in Basel, Zürich, Luzern und Bern
Die Musik florierte in der Alten Eidgenossenschaft im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung. Die Städte beschäftigten selbst Musiker, sogenannte Stadtpfeifer und Turmbläser, die für die Bevölkerung auf den Marktplätzen oder von Türmen herab musizierten. Wandernde Theatertruppen unterhielten das Volk mit musikalischen Schauspielen. In den katholischen Gebieten waren die Kirchen und Klöster florierende Musikzentren, und umherziehende Musiker spielten sowohl auf dem Land als auch in den Städten zum Tanz auf. Eine zentrale Rolle kam dem städtischen Bürgertum zu: Dieses musizierte ausgiebig und sammelte zum Teil sogar Musikalien; es war im 18. Jahrhundert die treibende Kraft bei der Entstehung erster öffentlicher Konzerte.
Das Musikzimmer
Wer im 18. Jahrhundert etwas auf sich hielt, und es sich leisten konnte, vertrieb sich die Zeit mit Musizieren. Besonders Angehörige des gehobenen Bürgertums (Kaufleute, Geistliche, Lehrer, Juristen, Ärzte) hatten oft bereits in der Kindheit eine Musikerziehung genossen. Viele besassen sogar eine kleine Musikbibliothek mit Musikalien aus den umliegenden Ländern. Eine dieser bedeutenden musizierenden Privatpersonen war der Basler Seidenbandfabrikant Lukas Sarasin.
Der Konzertsaal
Um gemeinsam erbauliche, geistliche Musik zu singen, gründeten musizierende Stadtbürger in vielen Städten der Deutschschweiz sogenannte Collegia Musica (Musikgesellschaften). Im Rahmen dieser «Musikgesellschaften» wurden das weltliche Musikrepertoire und die Instrumentalmusik immer bedeutsamer, und professionelle Musiker verstärkten die Musikdilettanten zusehends. Ab den 1720er-Jahren begann man öffentliche Konzerte zu geben. Mit diesen war eine städtische Attraktion geboren, für die bald Eintritt bezahlt werden musste.
Zur virtuellen Sarasin-Ausstellung geht es hier.